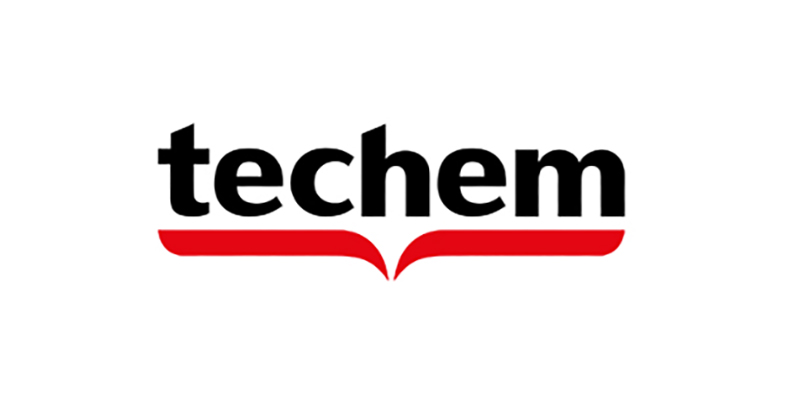IVD Berlin-Brandenburg
Kunden- und serviceorientiert wie seine Mitgliedsunternehmen tritt der IVD in der Region Berlin-Brandenburg für seine mehr als 650 Mitgliedsunternehmen auf. Als Verband aller qualifizierten Immobiliendienstleister in der Hauptstadtregion ist er einer der größten Interessenvertreter.
Für alle beratungsintensiven Berufe rund um die Immobilientransaktion und –verwaltung und mittlerweile auch für viele Projektentwickler und Bauträger ist der IVD ein All-inklusive-Service-Provider. Der IVD Berlin-Brandenburg DIE IMMOBILIENUNTERNEHMER qualifiziert, vernetzt, informiert und berät. Und Netzwerk bringt Umsatz, besonders in Zeiten der Marktwende!
Das IVD Bildungsinstitut in Berlin, hundertprozentige Tochter des Verbandes, ist mit mehr als 150 Weiterbildungsangeboten am Markt, natürlich mit Top-Konditionen für IVD-Mitglieder.